Es lohnt sich, Bernhard Pörksen zuzuhören.
Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, muss man sicherlich nicht mehr vorstellen. Wie kaum ein anderer Autor verstand er es in den letzten Jahren, aktuelle gesellschaftliche Phänomene wie etwa die Folgen der Digitalisierung („Die große Gereiztheit“, 2018) oder den kommunikativen Klimawandel („Die Kunst des Miteinander-Redens“, 2020, zusammen mit Friedemann Schulz von Thun) aufzugreifen, zu analysieren und nahbarer zu machen. Es erscheint nur folgerichtig, dass sich Pörksen nun dem „Zuhören“ bzw. „Gehörtwerden“ zuwendet, da dies ebenso einen elementaren Bereich des Kommunikationsklimas der Gegenwart darstellt.
Dabei ist sein aktuelles Buch „Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen“ kein Ratgeber, den man nebenbei liest und sich danach erleuchtet fühlt. Das will es auch gar nicht sein. Denn Pörksen bietet keine einfachen Rezepte an. Die mitunter durchaus schwere Kost will nicht belehren, sondern einen Anreiz schaffen, sich dem Thema zu nähern. Der Autor bietet durch zahlreiche Beispiele, aber auch fundiertem Wissen, Ansätze, wie ein besseres Zuhören und Gehörtwerden gelingen kann.
Was steht dem Zuhören im Weg?
Pörksen macht gleich zu Beginn deutlich, worin ein grundsätzliches Problem bestehe: „Vorurteile, Vorannahmen und nur schwer erschütterbare Überzeugungen bestimmen, was wir hören wollen.“ Diese Etikettierung von Menschen, ja eine regelrechte Verfeindungslust blockiert ein Zuhören und Verstehen. Doch warum ist das Zuhören so wichtig? Und wann beginnt es? Wieso wird plötzlich hingehört und wann hört das Weghören auf? Und wem soll, wem darf man überhaupt noch zuhören? Und wem auf keinen Fall? Diesen Fragen und der Suche nach Ursachen sowie Wirkungsmustern im Zusammenspiel von eigener Lebenserfahrung, kollektivpsychologischer Dynamik und medialen Rahmenbedingungen geht der Medienwissenschaftler nach. Denn besonders in Zeiten von Krisen und Kriegen, von Missbrauch und Gewalt gewinnt das empathische Zuhören, eine neue Offenheit und ein tieferes Verstehen immer mehr an Bedeutung.
Über allem aber steht in einer Zeit, in der Populisten und rechtsextreme Parteien überall auf der Welt mächtiger werden, laut Pörksen die eine entscheidende Leitfrage: Wie erreicht man Menschen, die man nicht mehr erreicht?
Zuhören beginnt mit Offenheit
Wie schwer es Pörksen selbst fiel, sich dem Thema zu nähern, beschreibt er im ersten Kapitel. Den Zugang bieten ihm - dem profilierten Wissenschaftler - überraschenderweise nicht Texte über Philosophie, Literatur oder Psychologie. Vielmehr beherzigt er den Rat eines Freundes: „Du musst persönlich werden.“ Und genau das macht der Autor. So nähert er sich schrittweise und auf zunächst sehr persönliche Weise dem Thema, hält immer wieder inne, reflektiert Gewesenes ebenso wie seine aktuelle Wahrnehmung und Vorstellung. Er, der über sich selber sagt, kein guter Zuhörer zu sein, hört hin, will selbst verstehen, indem er seine Gedanken zu Papier bringt. Will offen bleiben und sich nicht durch Vorurteile die Sicht verstellen.
Ungewöhnlich, dafür sehr bewegend ist dann sein Einstieg in das Thema: der vertuschte Missbrauch an der Odenwaldschule. Hiervon ausgehend skizziert Bernhard Pörksen in den ersten Kapiteln seines Buches zunächst die Konturen einer Philosophie des Zuhörens, bei der er auch eigene Motive und (traumatische) Erfahrungen („Tiefengeschichte“) aus seiner Schulzeit schildert. Daran schließen sich im Weiteren detaillierte Beobachtungen einer Praxis des Zuhörens an, die sich vor allem mit dem Ukrainekrieg, der Entstehung sozialer Netzwerke im Silicon Valley und der Klimakrise beschäftigen. Das Buch endet in der Gegenwart der aktuellen Diskurse und einer Auseinandersetzung mit der Politik des Zuhörens.
Wie beginnt das richtige Zuhören?
Doch wie hört man eigentlich zu bzw. kann man auch anders zuhören? Hört man nur sich selbst gefangen im System der eigenen (Vor-)Urteile und blockiert somit eine Berührung mit der Welt des anderen und einer fremden Wirklichkeit (Ich-Ohr-Zuhören) oder versucht man, sich ohne egozentrische Aufmerksamkeit der Welt des anderen zu nähern, zu verstehen und sich für ihre Andersartigkeit zu öffnen (Du-Ohr-Zuhören)? Wichtig sei es vor allem, die Perspektive des anderen einzunehmen - auch wenn man diese nicht akzeptieren müsse und sich von ihr durchaus distanzieren könne.
Dass es in gesellschaftlichen oder auch politischen Kontexten auch zu einer plötzlichen und unerwarteten kollektiven Zuhörbereitschaft komme, obwohl man sich vielleicht lange gegen die Wahrheit verschlossen habe, liege laut Pörksen auch an einem veränderten Wahrnehmungskontext, der das gerade noch nahezu Undenkbare nun denkbar mache. Nicht zuletzt spricht Pörksen ein Paradoxon an: Trotz fortschreitender Digitalisierung und der rasenden Entwicklung sozialer Medien, mit denen wir immer mehr Menschen erreichen können, wird es immer schwieriger, im großen Rauschen Gehör für die wirklich relevanten Themen zu finden. Ein Bereich, auf den Pörksen in seinen früheren Werken bereits einging.
Kann man noch gehört werden?
Pörksens Fazit erscheint auf den ersten Blick ernüchternd, zeigt aber auch basierend auf den Ideen und Eckpfeilern der Aufklärung Möglichkeiten für den Menschen auf, die bestehenden (individuellen) Hindernisse zu überwinden: „Wirkliches Zuhören ist […] vielleicht nichts für die große Politik, nichts für die Arena der Talkshows und den Austausch von vorab einstudierten Fertigantworten, nichts für das Aufeinander-Eindreschen in sozialen Netzwerken. Wirkliches Zuhören ist […] gelebte Demokratie im Kleinen, Anerkennung und Akzeptanz von Verschiedenheit, Suche nach dem Verbindenden, Klärung des Trennenden, gemeinschaftliche Erfindung einer Welt, die überhaupt erst im Miteinander-Reden und Einander-Zuhören entsteht.“
Fazit
In gewohnt eloquenter, bildhafter Weise nähert sich Bernhard Pörksen in seinem neuen Sachbuch dem Thema „Zuhören“. Frei von Belehrungen und gar Idealisierungen zeigt der Autor Wege auf, wie man sich der Welt mehr öffnen kann, indem man sie anders wahrnimmt, seine Perspektive verändert und man frei von Vorurteilen dem Anderen begegnet. Gerade in den jetzigen Zeiten lohnt es sich mehr denn je, Bernhard Pörksen zuzuhören, auch wenn letztendlich jeder seinen eigenen Weg finden muss. Einen Weg, den man nur in kleinen Schritten gehen kann und der sicherlich mühsam ist - dafür aber umso wichtiger.
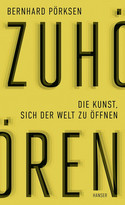



Deine Meinung zu »Zuhören«
Wir freuen uns auf Deine Meinungen. Ein fairer und respektvoller Umgang sollte selbstverständlich sein. Bitte Spoiler zum Inhalt vermeiden oder zumindest als solche deutlich in Deinem Kommentar kennzeichnen. Vielen Dank!